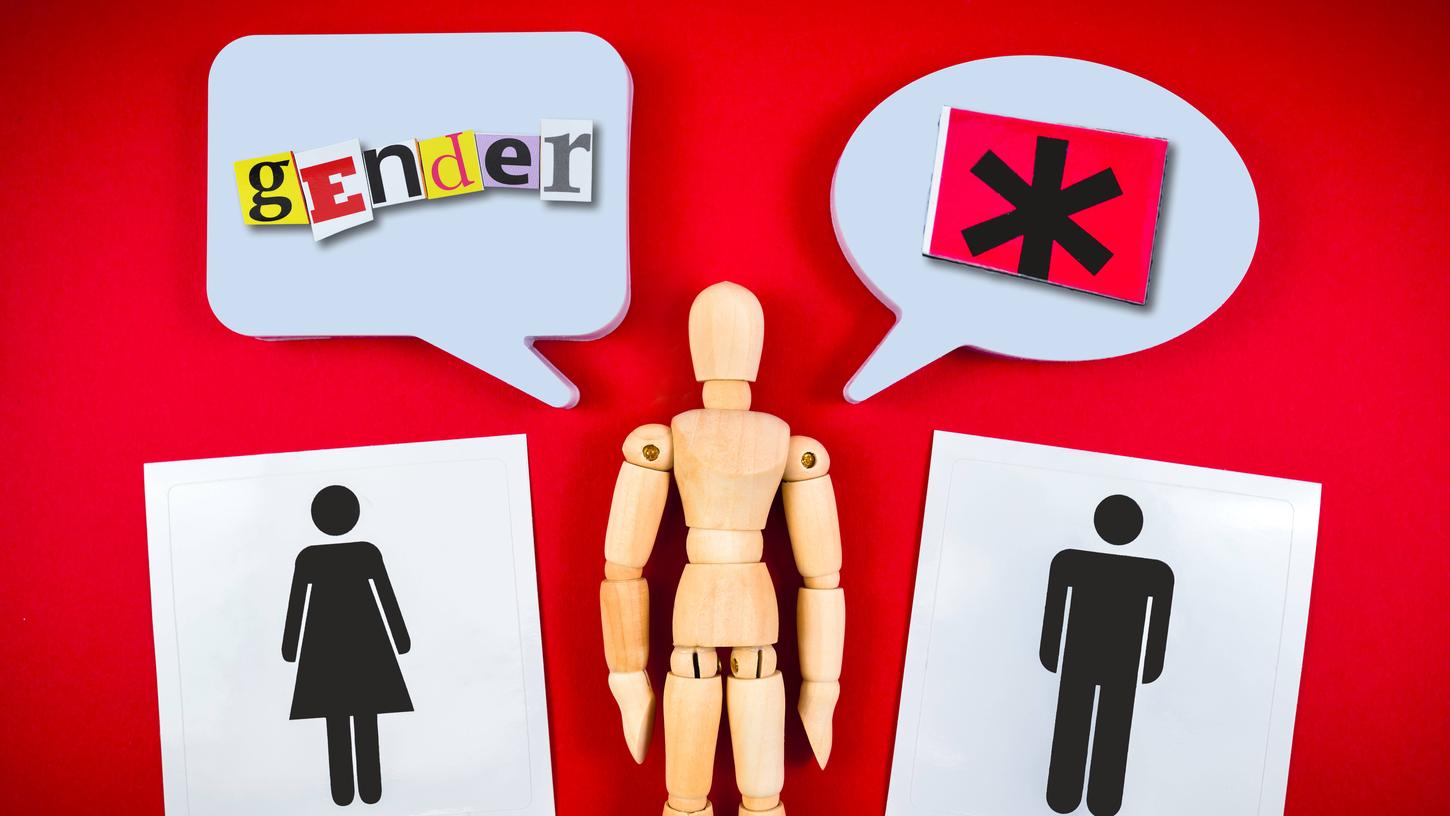
Geschlechtergerechte Sprache
Kommentar: Das Gendersternchen kann viele Probleme nicht lösen
Ein Sternchen erregt derzeit die Gemüter. Die Einen feiern es als ultimatives Mittel, unterdrückende Machtstrukturen zu beseitigen. Die Anderen sehen darin den Untergang der deutschen Sprache. Wir Journalisten sind uns uneinig, wie wir mit dem Problem umgehen wollen. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat kürzlich gemeinsam mit einigen anderen wichtigen Agenturen bekanntgegeben, dass sie weiterhin auf ein Gendersternchen, einen Doppelpunkt oder Unterstrich verzichten wird.
Als ein Grund wurde in dem Statement genannt, dass die Kunden – also regionale Plattformen wie die unsere – auf diese Schreibweise noch weitestgehend verzichten. Ein bisschen lustig ist das schon. Denn die Kunden – etwa unsere Plattform – würden wahrscheinlich weniger zurückhaltend mit der Einführung des Sternchens sein, wenn die dpa diese Richtung vorgäbe. So warten alle darauf, dass irgendjemand den ersten Schritt macht.
Wir stellen uns Männer vor
Fakt ist: Eine meinungsstarke Gruppe, die allerdings laut Studien nicht die Mehrheit in Deutschland stellt, möchte Frauen und Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen, in der Sprache besser repräsentiert sehen. Wenn wir Ärzte sagen, stellen wir uns Männer vor. Wir meinen nicht, wie es die Verfechter des generischen Maskulinums postulieren, die Ärztinnen mit. Diese Beobachtung halte ich für zutreffend. Das Problem der Repräsentation ist vorhanden.
Es wurde zunächst mit weiblichen Formen gelöst. Es kostet mehr Platz und mehr Zeit, immer beide Begriffe zu sagen, sprich: Ärztinnen und Ärzte. Aber damit könnte man leben. Noch komplizierter sind Sonderfälle, wo das medizinische Personal ausschließlich aus Frauen oder Männern besteht, und man nun eines von beiden korrekterweise weglassen muss. Das ist verwirrend. Aber geschenkt.
Geschlechtergerechte Sprache: Wie kommen Menschen mit Behinderung damit klar?
Was die Sache erst richtig schwierig macht, sind Menschen, die weder als männlich noch als weiblich bezeichnet und betrachtet werden wollen. Ja, die gibt es. Und ja, sie haben es nicht verdient, durch (sprachliche) Nichtbeachtung zu Außenseitern gemacht zu werden. Ob die Veränderung der Sprache gleich eine Veränderung der Machtverhältnisse mit sich bringen würde, sei dahingestellt. Gerechter wäre sie in jedem Fall. So entstanden Gendersternchen und Co. Sie sollen das Problem der Repräsentation lösen.
Ich bin in der Frage zwiegespalten. Einerseits stört es mich nicht, in Medien, in wissenschaftlichen Aufsätzen, in Statements der Bundesregierung das Sternchen zu sehen. Es regt mich zum Nachdenken an. Darüber, welche realen Ungerechtigkeiten in der Welt leider existieren. Darüber, dass wir alle einen Weg finden müssen, diese realen Ungerechtigkeiten zu beseitigen. So ist es von den Erfindern gewollt. Wenn es nach mir ginge, würde ich in meinen Artikeln das Sternchen benutzen.
Zwangssexualisierung? Scharfe Kritik an Gender-Plänen des Dudens
Aber: Ich möchte in einem Roman kein Sternchen lesen. Das ist keine Frage der Gewöhnung. Ich will beim Lesen nicht meine innere Stimme eine Pause machen lassen und dann mit einem betonten großen „I“ weiterlesen. Und dabei an eine nicht repräsentierte Gruppe Menschen denken, die in unserer Gesellschaft ungerecht behandelt wird. Das will ich nicht, wenn ich einen Roman lese. Ich will über die Themen des Romans nachdenken.
Von Musik gar nicht zu reden. Gibt es schon Songschreiber, die gendern? Ich habe noch keine gehört. Es würde auch nicht gut funktionieren.
Es gibt weitere Auswüchse. Will man etwa Sinti und Roma, die zu Recht nicht mehr mit dem verletzenden Z-Wort bezeichnet werden, gender-korrekt benennen, dann muss es „Sinti*zze und Rom*nja“ heißen. Ich kenne Menschen, die das tun. Die Intention dahinter verstehe ich und heiße sie gut. Aber ganz ehrlich: Für den Alltag taugt das nicht. Ich denke, dass selbst unter Akademikern nur eine Minderheit (auf Kosten der Verständlichkeit) so korrekt sein möchte, während es einer Mehrheit auf die Nerven geht. Von den sogenannten bildungsfernen Schichten gar nicht zu reden, an denen geht so eine Debatte komplett vorbei.
Scheuklappen bringen uns nicht weiter
Fazit: Die mangelnde Repräsentation von Minderheiten in unserer Sprache ist ein Problem, das Gendersternchen halte ich aber – will man es konsequent für jegliche geschriebene und gesprochene Sprache einführen – für eine unzureichende Lösung. Leider fällt mir keine bessere ein.
Ganz verkehrt ist es aber, diese Debatte mit hochmoralischer Empörung und ideologischen Scheuklappen zu führen – auf beiden Seiten. Mag das Sternchen sich ganz durchsetzen, in Teilbereichen, oder gar nicht. Es zu verordnen wäre genauso falsch wie es zu verbieten.
Wir möchten Ihre Meinung hören! Schreiben Sie uns gern zu diesem Thema an kultur@pressenetz.de. Die Zuschriften werden gesammelt und für einen weiteren Artikel ausgewertet.


7 Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen
Wowo
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass das, was ich lese für mich verständlich ist und mir der Spaß am Lesen nicht genommen wird. Da sollte man auch keinen Unterschied zwischen dem Lesen eines Romanes und einer wissenschaftlichen Abhandlung oder ähnlichem machen. In beiden Fällen möchte ich mich auf den Inhalt konzentrieren, beim Roman an Gefühl, Handlung und Spannung und im anderen Fall an einer informativen Berichterstattung. Wichtig ist doch nur das Denken. Wenn ich Arzt sage, dann denke ich sowohl männlich, als auch weiblich, da ich an die Ärzte denke, bei denen ich Patient bin. Essentiell ist es, dass man in seinem eigenen Denken und Gewissen versucht, so gut wie möglich gerecht zu sein und niemanden zu übergehen. Über diese Thematik nachzudenken, sollte man in seiner Grundeinstellung haben und diese sollte man auch leben. Daran muss gearbeitet werden und nicht künstlich an Sternchen, Doppelpunkt und Unterstrich. Diese sollte man in den WhatsApp Nachrichten belassen.
miauxx
@aufgeklärt
Gut, dass Sie das Beispiel anderer Sprachen bringen.
Dass das Deutsche ein "generische Maskulinum" habe, stimmt nicht absolut. Des Weiteren handelt es sich dabei zunächst einmal um das Genus, also grammatische Geschlecht. Dass die meisten Berufsbezeichnungen die männliche Form haben, hängt zwar sicher damit zusammen, dass historisch gesehen Frauen keine Berufe hatten. Nun muss man sich eben überlegen, ob in einer Zeit, in der das längst überwunden ist, tatsächlich noch eine Notwendigkeit besteht, dieses künstlich ändern zu wollen. Es ist eine vollkommen unbewiesene Behauptung, dass bei "ich müsste mal zum Arzt" oder "ich gehe zum Bäcker" ausschließlich an Männer gedacht würde. Jeder möge das einmal für sich prüfen. Ich habe eine Hausärztin und werde beim Bäcker fast ausnahmslos von Frauen bedient. Manager sind dagegen fast immer noch Männer. Diese Realitäten bestimmen die Vorstellung und nicht das grammatische Geschlecht.
aufgeklärt
Es gibt Sprachen, die kein generisches Maskulinum verwenden. In diesen Kulturen müsste es ja um die Gleichberechtigung der Frauen viel besser bestellt sein. Die türkische Sprache wäre hier beispielhaft.
Zudem entstehen Wortungetüme wie Bürger*innenmeister*innenwahl.
Halte somit das Ganze für nicht zielführend.
Denken bestimmt die Sprache, nicht umgekehrt. Es handelt sich nur um öffentlich abverlangte Konventionsbekenntnisse.
Franke mit Rad und Auto
Der letzte Satz im obigen Artikel ist der beste. Aber genau das Überstülpen haben einige Weltverbesserer getan und damit den Unmut der Mehrheit herausgefordert. Meine Frau hat sich nie beschwert, weil sie nicht genügend angesprochen worden wäre. Es gehört zu unserem Grundverständnis, daß immer beide Geschlechter gemeint sind. Die Schreibweise von vermeintlichen Sprachverbesserern + innen (meine persönliche Art die Neuerungen zu konterkarieren) bremst nur beim Lesen, da komme ich regelmäßig ins Stolpern.
Wichtig ist, was ich dabei denke und nicht, was ich schreibe.
Das gilt auch für die ganzen Verbote von (angeblich) rassistischen Bezeichnungen.
Tanzkeks
Wie wäre es damit, das generische Maskulinum durch ein generisches Neutrum zu ersetzen. Und dann - analog zur explizit weiblichen Endung wie ...in/...innen - eine explizit männliche Endung neu einzuführen? Also z.B. ein ..er/...erren oder wie auch immer (Vorschläge gerne willkommen).
Beispiel: Es hieße dann geschlechtsneutral "das Lehrer" / Plural: "die Lehrer". Meine ich explizit Frauen, dann heißt es "die Lehrerin"/"die Lehrerinnen". Wenn ich explizit Männer meine, wäre es dann "der Lehrerer"/"die Lehrererrer". Und wenn ich mich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen möchte, bleibe ich halt bei der neutralen Form.
Wäre gewöhnungsbedürftig. Aber vermutlich nicht mehr als Gendersternchen, dafür würde es die Alltagssprache nicht verkomplizieren.